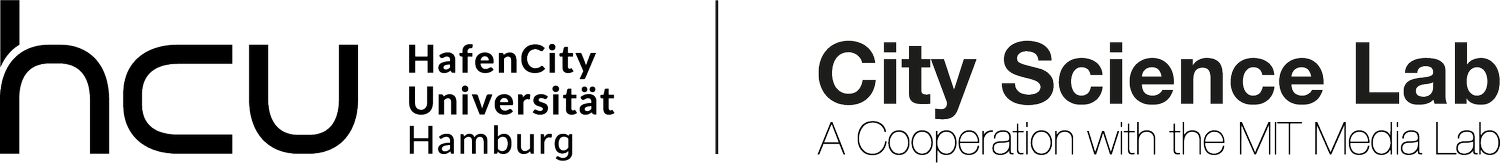Urbane Technologie für soziale Gerechtigkeit
Der folgende Artikel erscheint mit freundlicher Genehmigung vom Tagesspiegel Background und wurde dort am 04. September 2024 veröffentlicht.
Digitale Technologien können dabei helfen, soziale Ungleichheiten zu verringern. Digitale Plattformen, Bürgerbeteiligungs-Tools und kartografische Anwendungen machen viele Siedlungen erst sicht- und so planbar. Nur bedeutet das eben auch, dass mancher weiß, wo welche Siedlung abzureißen ist. Wie kann die Gratwanderung zwischen Tech for good und Tech for bad gelingen?
Das City Science Lab der Hafen City Universität, aus dem ich in diesen Werkstattberichten regelmäßig berichte, arbeitet nicht nur mit Ländern des sogenannten Globalen Nordens, also privilegierten Industrienationen mit politisch-gesellschaftlicher Freiheit und wirtschaftlicher Stabilität. Es arbeitet in Kooperation mit den Vereinten Nationen im United Nation Innovations Technology Accelerator Cities (Unitac) auch mit Ländern des Globalen Südens. Diese Begriffe sollen in einer globalisierten Welt die Situation der Länder möglichst hierarchiefrei und wertneutralbeschreiben. Wir arbeiten im Globalen Süden überwiegend in informellen Siedlungen, also dort, wo Menschen keinen rechtlichen Status wie Miete, Eigentum oder Nutzungsrecht auf dem Land besitzen, auf dem sie sich aufhalten. Zudem fehlen grundlegende Infrastrukturen wie Zugang zu sauberem Wasser, Abfallentsorgung, Bildung oder Gesundheitseinrichtungen. Ungefähr 30 Prozent der Menschheit lebt heute weltweit informell und es gibt viele Namen für diese Areale wie Slums, Favelas, Old Neighborhoods oder Barrios.
Die Arbeitsschwerpunkte von UNITAC Hamburg sind das Aufsetzen von Datenplattformen, digitale Bürger_innenbeteiligung, Kartenanwendungen mit Szenarienbildung oder der Einsatz von Bilderkennung beispielsweise mit Satellitenbildern. Im Juni dieses Jahres fand eine große hybride Konferenz statt, an der akademische Institutionen und Praktiker_innen diskutiert haben, wie datenbasierte urbane Technologien soziale Ungerechtigkeit verringern können. Digitale Datenprojekte aus Indien, Brasilien, Ruanda, Kenia, Argentinien, Kairo, Südafrika und anderen Ländern, in denen mit marginalisierten Gruppen gearbeitet werden, wurden vorgestellt und kritisch diskutiert. Wir stoßen immer wieder auf Ambivalenzen. Allein die Erhebung von Daten kann einerseits positivsein und den Planer_innen integrierte Stadtentwicklung ermöglichen. Und sie kann andererseits negativ sein, denn sie kann Überwachung erzeugen, die zum sofortigen Abriss solcher Siedlungen führen kann. Tech for goodkann also schnell in Tech for bad umkippen, je nach Regierungsform, die manchmal rasch wechseln kann.
Unsere Arbeit beginnt oft mit der elementaren Herausforderung, dass viele informelle Siedlungen nicht einmal auf Karten verzeichnet sind, weder bei Google Maps noch auf Fachkarten, die Planer_innen für die Entwicklung ihrer Städte und Regionen nutzen. Deshalb arbeiten wir mit Code for Africa, für die Laura Mugeha eindrucksvoll zeigte, dass beispielsweise in den Slums von Nairobi oder Lagos oft keine genauen georeferenzierten Daten existieren und wir einfach weiße Flecken auf den Karten sehen. Dies bedeutet, dass nicht nur wir uns dort nicht orientieren können, sondern auch nicht die Feuerwehr oder der Krankenwagen in Notfallsituationen. Code for Africa erhebt deshalb Daten, nummeriert Häuser und stellt diese Daten öffentlich zur Verfügung, beispielsweise für OpenStreetMap.
Die Kernfrage unserer Konferenz lautete: Welche Kriterien müssen erfüllt sein, damit Projekte mit und für marginalisierte Gruppen funktionieren und auch langfristig einen Nutzen erzeugen. Es gibt vier Aspekte, die dafür zentral sind. Sie lauten: Kollaboration, Datenrepräsentation, Implementierung und die langfristige Pflege der Technologien. Der Begriff Kollaboration ist angemessener als Partizipation, denn wir wollen gleichberechtigt, aktiv mit unseren Stakeholdern vor Ort arbeiten und diese nicht nur an etwas Bestehendem, von dem wir im Globalen Norden die Regeln definieren, partizipieren lassen. In postkolonialen Kontexten, in denen wir mit unserer Arbeit oft stehen, ist ein sehr sensibles Vorgehen gefragt, denn die Ressourcen sind in Ländern des Globalen Südens oft nicht ausreichend. Yael Borofsky formulierte es treffend: Zuhören, aber vor allem auch Kontrolle abgeben an Kolleg_innen vor Ort, macht Kollaboration erst möglich. Datenrepräsentation ist entscheidend, weil wir es oft mit dem Phänomen der Missing Data zu tun haben, was Mailén Garcia aus Buenos Aires zeigte. Unter der neuen Regierung des rechtspopulistischen Präsidenten von Argentinien, Javier Milei, wird die LGBTQ Gemeinschaft ausgegrenzt, weshalb die Organisation, DataGénero, Daten zu queeren Gemeinschaften sammelt, um zu informieren und aufzuklären. Die Implementierung funktioniert nur dann, wenn es einen wirklichen Bedarf gibt. Alexis Gatoni Sebarenzi zeigte dies an Projekten, die top down in Ruanda eingeführt wurden und zu Protesten führten. Andere wurden akzeptiert und erzeugten einen großen Effekt wie die Digitalisierung der Vermessung aller Grundstücke, was dazu führte, dass im ganzen Land digitalisierte Katastereinträge vorliegen. Für eine langfristige Pflege der Projekte mangelt es oft an zu wenig Kapazität vor Ort, weshalb wir darauf achten sollten, dass die Technologie einfach zu handhaben sind und wir traditionelle, handwerkliche Fähigkeiten mit digitalen verbinden. Dies betonte auch Nancy Odendaal und warb für einen „Smart African Urbanism“, der hybrid sei und Altes und Neues miteinander verbinde. Von diesem Input können auch wir lernen, denn im Smart City Bereich gibt es auch bei uns weiterhin viele Praktiken, die analoge und digitale Tätigkeiten verbinden.
Das Ergebnis der Konferenz ist neben einer lebendigen, sehr internationalen Netzwerkbildung ein Grundlagenbericht, der als Input für den Guideline-Prozess „People-Centred Smart Cities“ fungiert, den UN Habitat aktuell zusammen in Kooperation mit vielen Ländern steuert. Darin werden grundlegende Werte definiert, denen Städte im Umgang mit digitalen Technologien folgen sollten, den Nachhaltigkeitszielen ähnlich. Ein Motiv zog sich durch die ganze Konferenz: Simplicity is key. Ein Beispiel dafür gab eine unserer Keynote-Speakerin, Ayona Datta, die auf die ungleiche Stellung der Frau in Indien hinwies, die Diskriminierung und Gewalt erfährt. Einfache, schon bestehende Technologien, wie YouTube oder Messenger-Dienste können in Projekten genutzt werden und führen dazu, dass diese Frauen sich austauschen und Selbstbestimmung gestärkt wird, was sie als wichtigen Bestandteil einer „digitalen Demokratie“ versteht. Jede Technologie ist kulturell eingebettet, es braucht Vertrauen, um gut zusammenzuarbeiten, Verantwortlichkeit (Ownership) und Handlungsmöglichkeit (Agency) auf der Seite der Partner_innen. Die Technologie sollte wie überall, aber hier ganz besonders, nur stille Gehilfen sein. Je einfacher und je stärker sie am Bedarf orientiert ist, desto mehr Wirkung wird sie erzeugen.